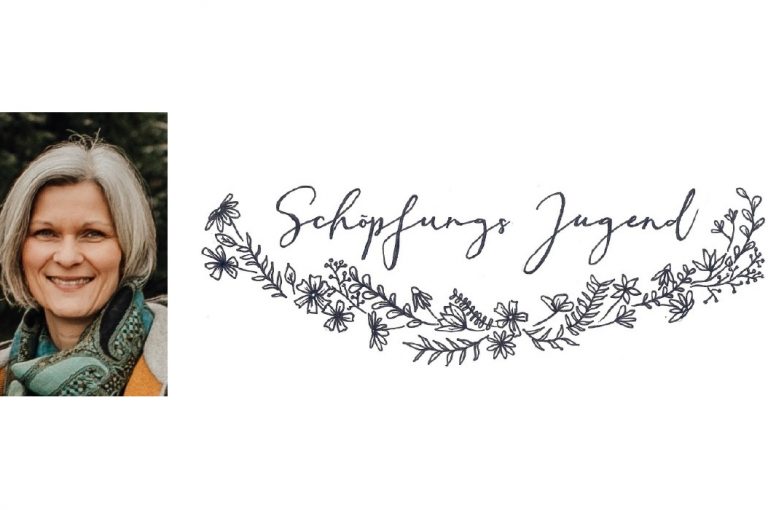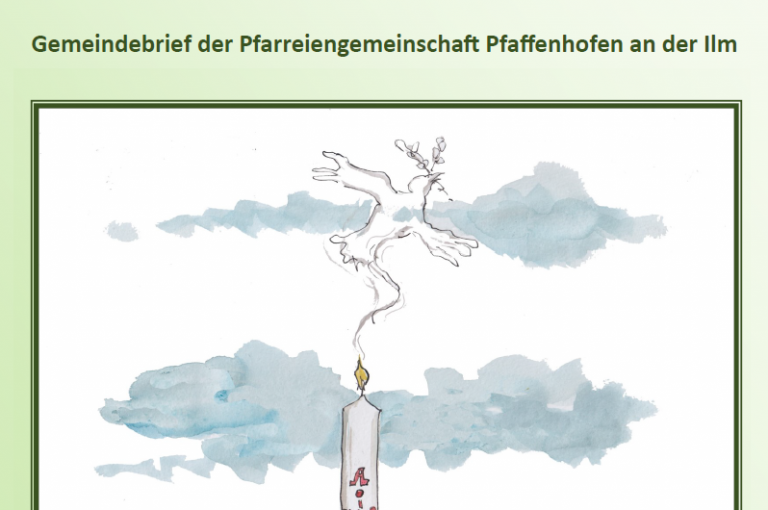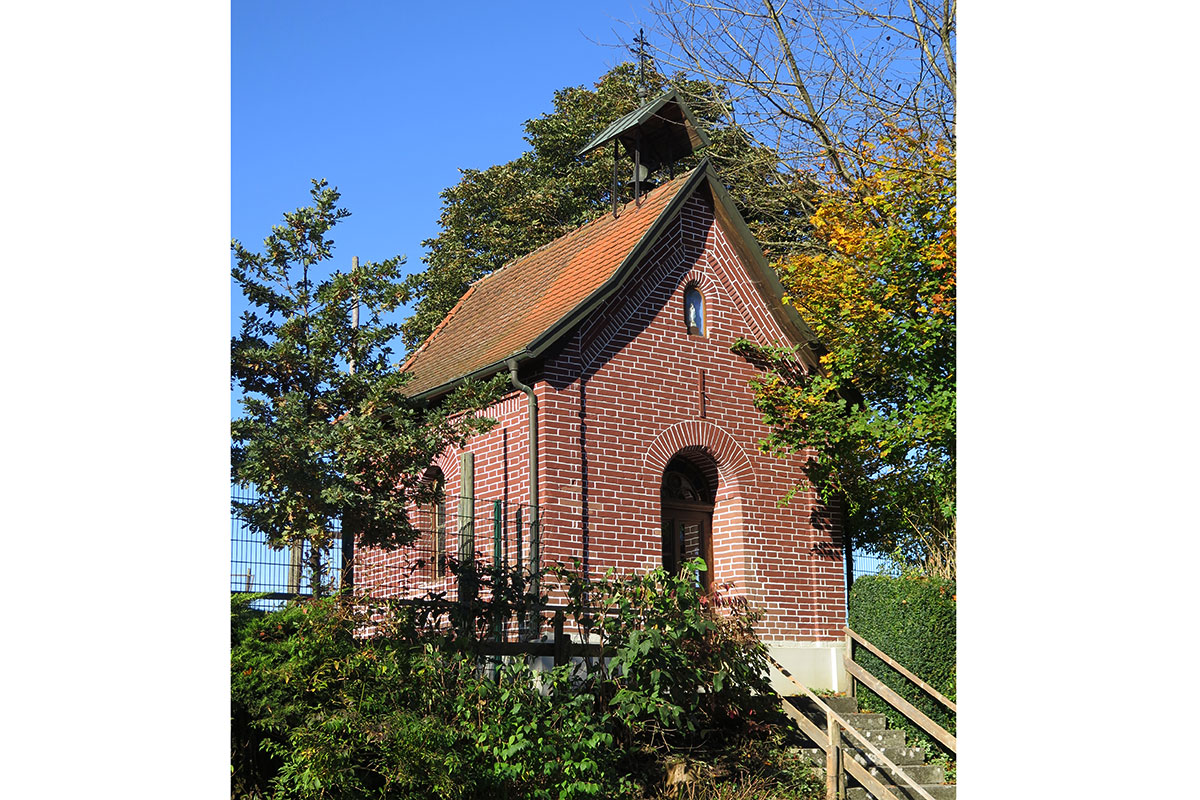Blick über Stadt mit Kirche (Bild 1 von 14)
Die Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist zwischen Oberem Hauptplatz und Scheyerer Straße ist das Wahrzeichen der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm und Zentrum unserer Pfarrei. Um das Jahr 1400 erbaut (Jahreszahl „1393“ in der Apsis) ist sie über 600 Jahre alt.

Pfarrkirche vom Marktplatz aus (Bild 2 von 14)
Die dreischiffige Basilika entstand wohl an der Stelle eines Vorgängerbaus, der zusammen mit der Stadt im Städtekrieg durch Brand zerstört worden war (1388). Die gotische Bausubstanz mit den spitz zulaufenden Bögen prägt ihr äußeres Erscheinungsbild bis heute.

Terrakotta-Relief (Bild 3 von 14)
Noch älter als die Kirche selbst sollen drei Terrakotta-Reliefs in ihr sein, darunter jenes der Dornenkrönung (Bild). Auf die Zeit der Erbauung, als auch die Stadt wieder aufgebaut und mit einer Mauer befestigt wurde, verweist ein steinerner Schmerzensmann (Erbärmdeheiland) mit dem Wappen des Scheyerer Abts Konrad von Muhr (1401-1412).

Taufstein (Bild 4 von 14)
Von großem Wert für unsere nach dem Hl. Johannes dem Täufer benannte Pfarrei ist der gotische Taufstein. Zerbrochen fand man ihn bei Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche im Jahr 1983 in einem Mauerwerk. Nachdem er repariert worden war, konnte man ihn seiner ursprünglichen Bestimmung zurückgeben. Seither werden wieder Kinder in ihm getauft.

Gotisches Kreuz (Bild 5 von 14)
Ebenfalls aus der Verborgenheit zum Vorschein gelangte das vor dem Chorraum hängende gotische Kreuz. In einem Versteck war es in Vergessenheit geraten. Nach seiner Wiederentdeckung 1887 blieb es zunächst in Privatbesitz und kam später zu den Franziskanern nach Ingolstadt, von wo aus es schließlich nach der Jahrtausendwende den Rückweg nach Pfaffenhofen antrat.

Grabmal des Andreas Sparber (Bild 6 von 14)
Eingemauerte Epitaphien (Grabdenkmale) erinnern seit alter Zeit an herausragende Personen und Wohltäter der Stadt und der Pfarrei, wie hier an Andreas Sparber (+1518), welcher für die Stadtpfarrkirche eine Donnerstagsprozession stiftete, die rund vierhundert Jahre lang abgehalten worden ist.

Turm (Bild 7 von 14)
Der Kirchturm wurde mit dem Abschluss des Oberbaus erst um 1531 fertig. Seitlich im Norden an den Chorraum der Kirche angelehnt, schiebt sich der gut 77 Meter hohe Turm in den Oberen Hauptplatz vor. Darin wohnte bis 1686 der Türmer. Von oben rufen die Glocken und reicht der Blick weit über das Land.

Hauptschiff (Bild 8 von 14)
Nach dem Dreißigjährigen Krieg begann die umfassende Neugestaltung des Kircheninneren im Stile von Spätrenaissance und Barock. Der Wessobrunner Matthias Schmuzer schuf das Gewölbe unter Mitarbeit des Pfaffenhofener Maurers Hans Auer und schmückte es mit Stuck. Johann Pöllandt, gebürtig aus Rottenbuch, schnitzte die Apostelfiguren über dem Hauptschiff und dem Chor.

Seitenaltäre (Bild 9 von 14)
Der Hochaltar (1672, von Johann Pader in München), die vier Seitenaltäre (Corpus-Christi-Altar im Bild links, Sebastiansaltar im Bild rechts, St. Anna-Altar, Marienaltar) und die Kanzel mit dem Wappen des Pfarrers Matthias Sibenhärl wurden gefertigt und angebracht. Chorgestühl und Kirchenbänke sind Neuerungen des 18. Jahrhunderts. Der Innenraum bekam damit weitgehend sein heutiges Gesicht.

Kreuzaltar (Bild 10 von 14)
Der Kreuzaltar mit dem Schrein des Hl. Felix wurde wohl Anfang des 19. Jahrhunderts in die Stadtpfarrkirche gebracht und zunächst im Chorraum aufgestellt. 1833 kam er an seinen heutigen Platz, wo sich zuvor das Südportal befunden hatte. Zu diesem war man über den Friedhof gelangt, der bis 1798 die Stadtpfarrkirche umgab.

Hochaltar (Bild 11 von 14)
Johann Kaspar aus Obergünzburg malte 1857 ein neues Altarblatt (Johannes d. T. weist auf das Lamm Gottes hin). Es wurde 1958 vom Pfaffenhofener Künstler Michael Weingartner umgestaltet. Den Tabernakel entwarf 1915 der Münchner Architekt Anton Bachmann. Aus dem 17. Jahrhundert erhalten ist noch das Auszugsbild von Anton Wurm aus Geisenfeld, das die Enthauptung des Johannes darstellt.

Lourdes-Grotte (Bild 12 von 14)
Als Werk von August Dirigl entstand 1888 eine Lourdes-Grotte im Läuthaus des Turmes. Pfarrer Ludwig Kohnle ließ die Stadtpfarrkirche 1913/14 nach Westen um zwei Joche verlängern. Die Kreuzwegstationen des Günzburger Bildhauers Hans Hirsch in den Seitenschiffen stammen aus der Zeit der anschließenden großen Innenrestaurierung.

Orgel (Bild 13 von 14)
Ihre neue Orgel von Hubert Sandtner in Dillingen mit drei Manualen und Pedal erhielt die Kirche 1976. Das Instrument besteht aus 2785 Zinn- und Holzpfeifen. Oben stehen Figuren des Täufers Johannes (1976) und des Bischofs Ulrich (18. Jh.), unseres Bistumspatrons.

Perspektive (Bild 14 von 14)
Viele Generationen haben über die Jahrhunderte hinweg bis heute an Bau, Umbau, Weiterbau, Ausgestaltung und Erhalt unserer Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist als ihrem Gotteshaus gewirkt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mt, 18,20)